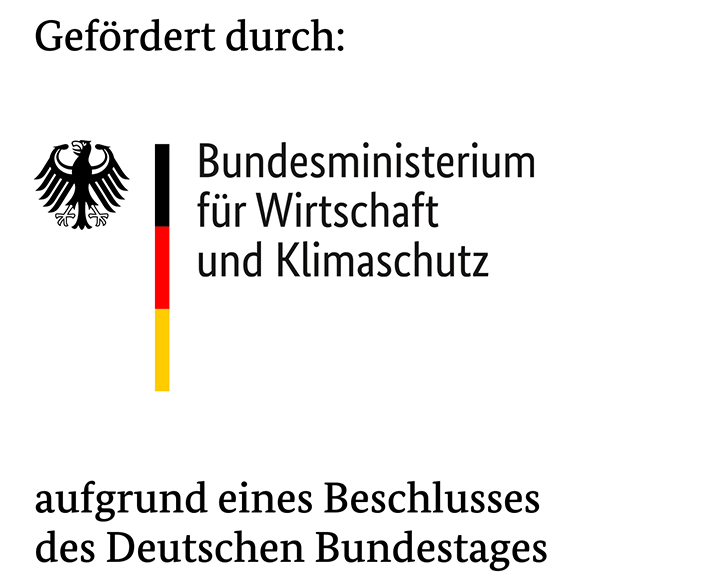Jahrestreffen 2025 des Forschungsnetzwerks Energiesystemanalyse
Herzlich Willkommen auf der Eventseite zur Jahreskonferenz 2025 des Forschungsnetzwerks Energiesystemanalyse.
Die Veranstaltung findet am 6. und 7. Mai 2025 im Maritim proArte Hotel Berlin, Friedrichstraße 151/Dorotheenstraße 65, 10117 Berlin statt.
Auf dieser Seite können Sie sich für die Veranstaltung anmelden und erhalten Informationen zur Agenda und den Inhalten der angebotenen Workshops.

Agenda
Workshops
In den Workshopsessions finden jeweils parallele Workshops in kleineren Gruppen statt, für die sie sich bei der Anmeldung zur Veranstaltung ebenfalls anmelden können. Eine Teilnahme an einem Workshop ist nur nach vorheriger Anmeldung möglich.
Workshopsession I
„Systemanalyse und Stakeholder-Kommunikation bei der Gründung von Energiegemeinschaften: Ein systemischer Ansatz für den Erfolg“
Die Energiewende hin zu erneuerbaren Energiequellen ist eine der größten gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fördert zunehmend die dezentrale Energieversorgung. In diesem Zusammenhang spielen Energiegemeinschaften eine zentrale Rolle: Sie bieten Bürgern, Unternehmen und lokalen Akteuren die Möglichkeit, gemeinsam Energie zu erzeugen, zu nutzen und ins Netz einzuspeisen.
Die erfolgreiche Bildung und langfristige Nachhaltigkeit von Energiegemeinschaften erfordern jedoch eine sorgfältige Planung und Organisation. Ein entscheidender Faktor in diesem Prozess ist die Systemanalyse, die eine ganzheitliche Betrachtung des gesamten Systems einer Energiegemeinschaft unter Einbeziehung der beteiligten Akteure ermöglicht. Besonders wichtig ist die Kommunikation mit allen relevanten Akteuren. Jeder Stakeholder bringt seine eigenen Interessen, Erwartungen und Ziele mit, die oft unterschiedlich oder sogar widersprüchlich sind. Durch eine fundierte Systemanalyse können diese unterschiedlichen Perspektiven frühzeitig erkannt, besser verstanden und aufeinander abgestimmt werden.
Das NRGCOM-Projekt1, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Kommunikationsrahmen und innovativer Ansätze zur Förderung der Zusammenarbeit bei energiebezogenen Initiativen konzentriert, dient in diesem Zusammenhang als Schlüsselbeispiel. Durch den Einsatz digitaler Tools und strukturierter Strategien zur Einbindung von Interessengruppen zeigt das Projekt, wie Systemanalyse und Kommunikation integriert werden können, um den Erfolg von Energiegemeinschaften zu gewährleisten. Die Projektergebnisse liefern umsetzbare Einblicke in die Abstimmung verschiedener Stakeholder-Interessen und die effektive Bewältigung von Herausforderungen.
Der Workshop bietet eine Einführung in die Grundlagen der Systemanalyse mit besonderem Schwerpunkt auf der Kommunikation zwischen verschiedenen Interessengruppen. Er bietet den Teilnehmern praktische Einblicke in die Durchführung einer solchen Analyse und stellt vielversprechende Kommunikationsstrategien vor. Konkrete Beispiele aus der Praxis und bewährte Best Practices, einschließlich Fallstudien aus dem NRGCOM-Projekt, werden vorgestellt, um theoretisches Wissen mit realen Erfahrungen zu verbinden.
Kurzablauf
1. Begrüßung und Einführung in das Thema Energiegemeinschaften und Systemanalyse (5 Minuten)
2. Impulspräsentation „Effektive Stakeholder-Kommunikation in Energiegemeinschaften: Ein systemischer Ansatz zur erfolgreichen Gründung und Kooperation“ (20–30 Minuten)
3. Aktivierungsübung „Stakeholder-Mapping und Kommunikationsplan-Entwicklung“: Gruppenarbeit, Präsentation und gemeinsame Reflexion (40–50 Minuten)
4. Abschluss und Zusammenfassung (5–10 Minuten)
Referent: Prof. Dr. Raimund Brotsack, raimund.brotsack@th-deg.de
Moderation: Agnes Frank MA, agnes.frank@th-deg.de
Rolle und Bedeutung der Kreislaufwirtschaft zur Erreichung von Treibhausgasminderungszielen und deren Modellierung
Die Europäische Union will bis 2050 eine kreislauforientierte und klimaneutrale Wirtschaft aufbauen um ihre Klimaziele zu erreichen. Die Kreislaufwirtschaft trägt dazu bei, industrielle Emissionen zu reduzieren und Ressourcen effizienter zu nutzen. Deren Aspekte werden bisher kaum in Energiesystemmodellen berücksichtigt. Dieser Workshop bietet eine Plattform um relevante Materialflüsse, Recyclingpotenziale, Umweltwirkungen und Ansätze der Modellierung der Kreislaufwirtschaft kennenzulernen und zu diskutieren.
Der Workshop ist fünf geteilt. Gestartet wird mit einem 20-minütigen Überblick über die grundlegenden Konzepte der Kreislaufwirtschaft, die Verbindungen zur Materialeffizienz, sowie dem aktuellen Stand und den verknüpften Sektoren. Im Anschluss werden 5 Minuten Diskussionsthemen präsentiert, zu welchen sich die Teilnehmenden frei eingruppieren dürfen. Diese sollen im Anschluss 30 Minuten in Kleingruppen diskutiert werden. Zu den zu diskutierenden Themen gehört beispielsweise Anreizsysteme für Verbraucher und Produzenten, Herausforderungen und Vorteile der Modellierung von Recycling in Energiesystemmodellen sowie das Spannungsfeld zwischen Kreislaufwirtschaft und Materialeffizienz. Weitere Themen sind die Sinnhaftigkeit von Recycling für verschiedene Produkte und regionale Unterschiede bei Recyclingquoten und Sammelraten. Anschließend werden die Ergebnisse der Diskussion der Gesamtgruppe präsentiert. Abgeschlossen wird der Workshop mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse der Diskussionen und Überlegungen zur Fortsetzung.
Beteiligte Institute
Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung (IER)
Universität Stuttgart
Kontakt: Prof. Dr. Markus Blesl
Institute of Climate and Energy Systems (ICE-2)
Forschungszentrum Jülich GmbH
Kontakt: Arne Burdack
Lehrstuhl für Erneuerbare und Nachhaltige Energiesysteme
Technische Universität München
Kontakt: Andjelka Kerekes
Suche über Multi-Layer-Metadaten für NFDI4Energy Repositories
Das Projekt SOMMER (Search over Multi-Layer Metadata for NFDI4Energy Repositories) ist eine Initiative, die darauf abzielt, einen anpassungsfähigen, domänenübergreifenden Metadatenkatalog zur Unterstützung der Energieforschung zu erstellen. Unter Verwendung der bestehenden Technologien Databus und MOSS (Metadata Overlay Search System) verbessert das Projekt die Metadaten-Annotation und die Suchfunktionen für verschiedene Datensätze in NFDI4Energy und leistet damit einen wichtigen Beitrag zu den Zielen der FAIR-Datenverwaltung (Findable, Accessible, Interoperable, and Reusable).
Zu den Hauptzielen von SOMMER gehören die Verbesserung der Benutzeroberfläche und -erfahrung, die Förderung des Engagements der Gemeinschaft und die Verbesserung der Kompatibilität von Metadaten zwischen verschiedenen Repositories. Durch die Einbeziehung des Feedbacks von Energieforschern will das Projekt ein gut integriertes, von den Benutzern akzeptiertes Metadatenregister schaffen. Diese Registry wird verschiedene wissenschaftliche Bereiche unterstützen und dabei anerkannte Standards wie DCAT, SPARQL und RDF einhalten, um die Interoperabilität mit Tools wie LDM und TIB Terminology Services zu gewährleisten.
Durch die Integration mehrerer Metadatenstandards geht SOMMER auf die Herausforderungen unterschiedlicher Datenquellen ein und ermöglicht es Forschern, Datensätze von einer zentralen Plattform aus mit Anmerkungen zu versehen. Dieser Ansatz fördert eine breite Akzeptanz innerhalb der Energieforschungsgemeinschaft, indem er die domänenspezifischen und interdisziplinären Anforderungen an Metadaten unterstützt. Letztendlich bietet SOMMER eine skalierbare Lösung mit bereichsübergreifenden Suchfunktionen, die das Potenzial hat, zu einem Referenzmodell für Metadatenkataloge im breiteren NFDI-Rahmen zu werden.
Im Rahmen des Workshops wollen wir die aktuelle Implementierung von Databus und MOSS vorstellen und Feedback sammeln, um die Funktionalitäten und die Schnittstelle zur Suche nach Forschungsdaten zu verbessern.
Agenda
|
30 min |
Begrüßung und Einführung in Databus und MOSS, Demonstration der aktuellen Funktionalitäten |
|
15 min |
Zeit für Experimente mit Databus und MOSS |
|
20 min |
Feedback zu Suchstrategien: Wie würden Sie nach Forschungsdaten suchen und wie würden Sie eine große Anzahl von Suchergebnissen eingrenzen? |
|
20 min |
Feedback zur Benutzeroberfläche des MOSS und Ideen zur Umsetzung der Suchstrategien |
|
5 min |
Nächste Schritte |
Ansprechperson: Carsten Hoyer-Klick
Zukunftsperspektiven von Negativemissionstechnologien (NETs)
Organisation: Hochschule Offenburg, Fraunhofer ISE, Institut für ökologische Wirtschaftsforschung IÖW
Im Rahmen des Jahrestreffens des Forschungsnetzwerks Energiesystemanalyse des PTJ soll ein Workshop durchgeführt werden, der sich der Rolle von Negativemissionstechnologien (NETs) widmet. Langfristig wird laut IPCC erwartet, dass NETs entscheidend für die Energiewende sind, um negative Emissionen zu erreichen oder unvermeidbare Restemissionen zu kompensieren. In der derzeitigen Diskussion spielen NETs aber eine untergeordnete Rolle. Ziel ist es, die Bedeutung von NETs in der heutigen Energielandschaft zu diskutieren und Empfehlungen zu erarbeiten.
Workshop-Struktur
1. Einleitung (30 Minuten):
• Einführung in das Thema NETs – Hochschule Offenburg - 6 Min
• Pyrolyse als NET in MyPyPSA-Ger und PyPSA-Eur – Hochschule Offenburg - 8 Min
• Vorstellung von NETs in REMod - Fraunhofer ISE - 8 Min
• Ökonomie von Pyrolyse - IÖW - 8 Min
2. Diskussionsrunden (45 Minuten): Die Teilnehmenden werden in drei Gruppen aufgeteilt, um unterschiedliche Dimensionen von NETs zu erkunden. Jede Gruppe diskutiert 15 Minuten ein Thema, bevor sie weiterwechselt.
Themen der Gruppen:
• Gruppe 1: NETs - Technologien und deren Abbildung in der Energiesystemanalyse.
• Gruppe 2: NETs - Chancen und Risiken (bis 2060)
• Gruppe 3: NETs – Empfehlungen, Forschungsbedarf
3. Abschluss und Zusammenfassung (15 Minuten):
• Konsolidierung der Diskussionsergebnisse aus den Gruppen.
• Offene Fragerunde und abschließendes Feedback.
Dieser Workshop bietet eine Plattform für den Wissensaustausch und die Diskussion über die strategische Einbindung von NETs in zukünftigen Energiesystemen. Wir laden alle Teilnehmenden herzlich ein, sich an diesem Dialog zu beteiligen
Ansprechperson: Niklas Hartmann
Wo wird in Zukunft die Regeleistung in den Stromnetzen eingebracht?
In unserem Forschungsprojekt „AGil: Akteurstimulierende und sektorkoppelnde Geschäftsmodelle für Stadtwerke im ländlichen Raum“ wollen wir uns unter anderem mit neuen Aufgaben der ländlichen Energieversorger beschäftigen. Wir stellen die These auf, dass einige Regelleistungen (Frequenzstabilität, Momentanreserve, etc.) von der Höchst- und Hochspannungsebene auf die Mittel-, bzw. Niederspannungseben wandern werden. Wir wollen diese These bildlich darstellen (A0-Poster) und dann mit einige Fragen an das Plenum diese und deren Folgen diskutieren.
Technische Fragen
- Wo wird in Zukunft die Regelleistung eingebracht werden?
- Welche technischen Komponenten können Regelleistung anbieten?
Nicht-technische Fragen
- Welche Herausforderungen bringt eine Verlagerung der Produktion von HöS und HS auf NS und MS?
- Welche Geschäftsmodelle ergeben sich?
Diskussion
Welche sozio-ökonomischen Folgen hat eine solche Umstellung?
Organisatoren:
Dirk Böllert von ADAICA Deutschland
Frau Anna-Lena Lesch Universität Göttingen.
Energiesystemmodellierung mit PyPSA-Eur
Der 90-minütige Workshop führt die Teilnehmenden in das open-source Energiesystemmodell PyPSA-Eur ein (https://pypsa-eur.readthedocs.io), das für die Analyse von Transformationspfaden des europäischen Energiesystems entwickelt wurde. Mit diesem Modell können Strategien zur Klimaneutralität, notwendige Infrastrukturinvestitionen und sektorenübergreifende Lösungen – von der Wasserstoffwirtschaft über die Wärmewende bis zum Carbon Management – analysiert werden.
Der Workshop gliedert sich in drei Blöcke:
Block 1 (30 Min.): Nach einer kompakten Einführung in die Grundstruktur von PyPSA-Eur präsentieren wir verschiedene Anwendungsszenarien. Diese reichen von der Analyse europaweiter Wasserstoffnetze über die Integration erneuerbarer Energien bis zur Bewertung von Carbon Management Strategien. Anhand konkreter Beispiele zeigen wir, wie das Modell für wissenschaftliche Analysen und Politikberatung eingesetzt wird.
Block 2 (30 Min.): Im zweiten Teil demonstrieren wir live den typischen Workflow anhand eines Beispielszenarios. Wir zeigen, wie verschiedene Parameter angepasst werden können und gehen dabei detailliert auf die technischen Voraussetzungen und Konfigurationsmöglichkeiten des Modells ein, von der räumlichen und zeitlichen Auflösung bis zur Technologie und Szenarioauswahl.
Block 3 (30 Min.): Der letzte Block widmet sich aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen. In einer moderierten Diskussion werden Erfahrungen ausgetauscht und Lösungsansätze für Herausforderungen in Modellierungsfragen erarbeitet. Dabei werden sowohl wissenschaftliche als auch praxisrelevante Aspekte für Industrie und Politikberatung behandelt.
Ansprechperson: Fabian Neumann
Wie kann Unsicherheiten beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft begegnet werden? Einblicke und Diskussion zu Fragen der Resilienz und der Ausgestaltung von Rahmenbedingungen
Dieser Workshop widmet sich der Frage, wie Unsicherheiten beim Aufbau der deutschen Wasserstoffwirtschaft im Kontext eines europäischen Wasserstoffmarktes begegnet werden kann. Basierend auf den Ergebnissen eines Marktgleichgewichtsmodells für den europäischen Wasserstoffmarkt und eines dynamischen makroökonomischen Modells für die deutsche Volkswirtschaft werden die Teilnehmer eingeladen, zentrale geostrategische Herausforderungen zu diskutieren. Ziel ist es, Strategien für den Aufbau einer resilienten grünen Wasserstoffwirtschaft zu identifizieren und deren Auswirkungen auf Wirtschaftlichkeit und makroökonomische Stabilität zu beleuchten. Weiterhin soll auf die Ausgestaltung der Rahmenbedingungen eingegangen werden, die das Entstehen problematischer Pfadabhängigkeiten beeinflussen können. Die Ergebnisse der Diskussionen sollen praktische Impulse für Politik, Wirtschaft und Wissenschaft liefern, um die deutsche Wasserstoffstrategie widerstandsfähig und zukunftsfähig zu gestalten und potenzielle Lock-In-Effekte beim Aufbau einer nachhaltigen Wasserstoffwirtschaft zu vermeiden.
Ablauf:
Der Workshop ist auf 1,5 Stunden und auf eine maximale Teilnehmendenzahl von 40 Personen angelegt und kombiniert fachliche Impulse mit interaktiven Elementen:
- Einführung und Zielsetzung (5 min):
Begrüßung und Einführung in die Begrifflichkeiten - Hintergrundinformationen aus den Projekten ELYAS und NoRaLock-H2 (25 min):
- Marktgleichgewichtsmodell: Analyse des europäischen Wasserstoffmarktes, mit einem Fokus auf Handelsbeziehungen, Importabhängigkeit und Marktdynamiken.
- Dynamisches ABM-SFC-Modell: Untersuchung makroökonomischer Auswirkungen der Wasserstofftransformation in Deutschland hinsichtlich Stabilität von Lieferketten, Investitionen und Beschäftigung (ABM: agentenbasiert, SFC: stock-flow-consistent).
- Kurzvorstellung des Projekts NoRaLock-H2: Analyse drohender Lock-In-Effekte und möglicher Gegenmaßnahmen beim Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Deutschland mit sozialwissenschaftlich fundiertem Modellverbund.
- Interaktive Diskussion in Kleingruppen von etwa 5-8 Personen (45 min):
Nach den Präsentationen werden zentrale Fragestellungen in Kleingruppen diskutiert, darunter: - Welche Erwartungen gibt es an zukünftige Wasserstoffmärkte? Welche Akteure werden aktiv sein und wie wird die Preisbildung stattfinden?
- Welche externen Schocks (z. B. Preisschwankungen, geopolitischen Risiken) sind vorstellbar? Wie resilient ist die deutsche Wasserstoffwirtschaft gegenüber diesen externen Schocks?
- Welche Lock-In-Gefahren drohen und müssen beim Aufbau der Wasserstoffwirtschaft vermieden werden?
- Welche Strategien können die Versorgungssicherheit und Anpassungsfähigkeit erhöhen?
- Wie lassen sich Resilienzmaßnahmen mit wirtschaftlichem Wachstum und Klimazielen vereinbaren?
- Abschluss und Ergebnissicherung (15 min):
Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden im Plenum präsentiert und zusammengeführt. Abschließend werden Handlungsempfehlungen und offene Forschungsfragen festgehalten.
Ansprechperson: Theresa Klütz
Workshopsession II
Zukunftswissen für die Energiewende: Die Beispiele integrierte Energieszenarien und Long-term Governance
In der wissenschaftlichen Forschung werden Futuring-Techniken eingesetzt, um zukünftige Entwicklungen und Spezifikationen zu untersuchen. Zu den bekanntesten Methoden gehören Delphi-Umfragen, Computersimulationen, Szenarioanalysen, Theorien des Wandels, Horizon Scanning, Cross-Impact-Balance-Analyse, Technologieprognose oder Backcasting. Dabei ist wichtig anzuerkennen, dass keine einzelne Methode optimale Ergebnisse garantieren kann aufgrund der in sozio-technischen Systemen inhärenten Komplexität, Unsicherheit und Ambivalenz. Ein Weg mit diesem Dilemma umzugehen, ist der Versuch, die sozio-technische Komplexität besser in wissenschaftliche Untersuchungsmethoden zu integrieren. Führt höher Komplexität zu besseren wissenschaftlichen Ergebnissen? Und wie verhält sich dies im Bereich von Methoden der Zukunftsforschung? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt des Workshops. Dabei werden zwei unterschiedliche Bereiche vorgestellt mit Arbeiten , die ein Mehr an Komplexität integrieren: Zum einen der integrierte Energieszenarien Ansatz, bei dem verschiedene Integrationstechniken entwickelt wurden; zum anderen der transformationstheoretische Ansatz Long-term Governance, bei dem ein Rahmenkonzept für eine Politik aus Langfristperspektive entwickelt wurde. Beide Ansätze werden im Workshop kurz vorgestellt und kritisch diskutiert. Daneben gibt es Raum, weitere systemanalytische Ansätze für Zukunftswissen zur Energiewende vorzustellen. Der Workshop schließt bzgl. der Szenariomethode komplementär an den Workshop „Lastenheft für Energieszenarien: Was sollen und was können Energieszenarien leisten?“ und thematisiert hier übergreifend die Rolle der Komplexitätsintegration in wissenschaftliche Methoden.
Organisator:
- Dirk Scheer (KIT-ITAS), Kontakt: dirk.scheer@kit.edu
- Maximale Teilnehmeranzahl: 25
Koordinationsmechanismen und -kosten
Ansprechperson:
Oliver Ruhnau, Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln (EWI)
Christoph Weber, Lehrstuhl für Energiewirtschaft, Universität Duisburg-Essen
Kurzbeschreibung: Die Energiesystemanalyse geht meist von perfekter Koordination von Investitionen in Angebot, Nachfrage und Infrastruktur aus. Im Gegensatz dazu werden reale Energiesysteme und deren Transformationsprozesse durch imperfekte marktliche, politische, und planerische Mechanismen koordiniert. Die erforderliche Koordination kann bei den beteiligten Akteuren dazu führen, dass subjektiv erhebliche Risiken wahrgenommen werden – zum Beispiel aus Sicht eines Wasserstoff-Nachfragers: Wird der Anbieter tatsächlich zum vereinbarten Zeitpunkt die vereinbarte Menge liefern und wird die entsprechende Netzanbindung rechtzeitig fertig sein? Solche Koordinationsrisiken können auf volkswirtschaftlicher Sicht erhebliche Kosten einhergehen. In diesem Workshop möchten wir uns mit der Modellierung imperfekter Koordinationsmechanismen für langfristige Investitionsentscheidungen und deren Kosten beschäftigen. Salopp gesprochen geht es darum, das „Henne-Ei-Hühnerstall-Gehege“ Problem, d.h. Modellierungsmöglichkeiten für die Anbieter-Nachfrager-Netzbetreiber-Regulierungs-Koordination in den Blick zu nehmen.
Geplanter Ablauf
- 30 Minuten: Einleitung & Stand der Wissenschaft Impulse der Workshopleitenden und Ergänzungen/Diskussion im Plenum
- 30 Minuten: Koordination in der deutschen Energiewende Arbeit in bis zu 5 Kleingruppen zu verschiedenen Sektoren: Strom, Wasserstoff, Carbon Management, E-Mobilität, Wärmewende
Leitfrage: Wie kann die Energiesystemanalyse Koordinationsmechanismen und -Kosten in diesen Sektoren besser abbilden?
- 30 Minuten: Vorstellung und Diskussion der Ergebnisse der Kleingruppen im Plenum
Metadaten für Modelle in der Praxis
Ansprechpersonen : Christoph Schimeczek Eugenio Salvador Arellano Ruiz, Christoph Schimeczek, Ludwig Hülk, Mirjam Stappel, Patrick Kuckertz, Ulrich Frey und Carsten Hoyer-Klick
Deutsches Zentrum für Luft- & Raumfahrt e.V. , Reiner Lemoine Institut,3 Universität Osnabrück, Forschungszentrum Jülich
Motivation
Metadaten zur Beschreibung wissenschaftlicher Modelle stärken deren Transparenz, können die Nutzbarkeit der Modelle erhöhen und die Nachvollziehbarkeit ihrer Ergebnisse verbessern. Hierdurch fördern Modell-Metadaten den Wissenstransfer zwischen Entwicklern und Anwendern und erleichtern Modellkopplungen. Während in der Energiesystemanalyse die Verknüpfung von Daten mit Metadaten bereits große Beachtung findet, wird die Verbindung von Modellen mit Metadaten bisher noch wenig thematisiert und synergetische Potentiale bleiben ungenutzt.
Inhalte
In fünf Impulsvorträgen stellen Forschende aus vier verschiedenen Institutionen aktuelle Arbeiten und Erfahrungen zu Metadaten rund um Modelle in der Energiesystemanalyse vor. Im Anschluss bilden die Teilnehmenden 3 Arbeitsgruppen, die an wechselnden Stationen jeweils 15 Minuten interaktiv praxisrelevante Fragestellungen bearbeiten: 1) Hemmnisse und Schwierigkeiten beim Einsatz von Modell-Metadaten, 2) Nutzen & Anwendungspotentiale derselben, 3) bestehende Methoden, Tools und Empfehlungen für die Praxisanwendung. In einer abschließenden interaktiven Bewertungsrunde identifizieren alle Teilnehmenden besonders relevante Aspekte.
Vorläufiger Ablauf
5min Einführung
25min Impulsvorträge: Aktuelle Arbeiten zu Metadaten in Modellen der Energiesystemanalyse
• „Die OEP Model Factsheets – Aktueller Status und weitere Entwicklungen“
• „Ontologische Annotation von Daten: Erklärung der OEMetadata“
• „DataDesc – A framework for creating and sharing technical metadata on research software interfaces“
• „Metadatenunterstützung in FAME-basierten Energiemarktmodellen“
• „Metadaten Anti-Patterns: Beispiele aus dem DATEX II Standard“
5min Gruppeneinteilung: 3 Arbeitsgruppen
45min Gruppenarbeit: 3 interaktive Diskussionsstationen, 15 min pro Station
• Hemmnisse & Schwierigkeiten bei der Anwendung von Modell-Metadaten
• Nutzen & Anwendungspotentiale von Modell-Metadaten
• Tools & Best Practice zur Integration mit Schnittstellen & Plattformen
10min Interaktive Bewertung der erarbeiteten Ergebnisse
Computational Boundaries und Methoden zur Beschleunigung der Energiesystemanalyse unter Berücksichtigung von Unsicherheiten.
Ansprechperson: Sarah Berendes
Motivation & Zielsetzung
Die steigende Modellkomplexität in der Energiesystemanalyse stellt Forschende vor Herausforderungen: Sensitivitäts- und Robustheitsanalysen liefern wertvolle Erkenntnisse über die Auswirkungen von Unsicherheiten, führen jedoch zu einem erheblichen Rechenaufwand. Gleichzeitig bleibt ihre Bedeutung im politischen Diskurs oft unbeachtet, obwohl sie Entscheidungsprozesse verbessern und einen breiteren Lösungskorridor eröffnen können. Dieser Workshop thematisiert innovative Ansätze zur Modellvereinfachung, den Einsatz effizienter Algorithmen und spezialisierter Solver, um Rechenzeiten zu reduzieren, ohne die Aussagekraft der Modelle zu gefährden. Ziel ist es, bewährte Methoden zu identifizieren, Best Practices zu bündeln und neue Perspektiven für eine leistungsfähige und praxistaugliche Energiesystemanalyse zu entwickeln.
Ablauf
1. Vorstellungsrunde, & Thema einleiten (15 Min.)
2. Kurzpräsentationen zu Methoden & Herausforderungen (je 5–10 Min.)
a. Stadt-Land-Energie (RLI)
b. ARTESIS, PEREGRINE (DLR)
c. Weitere Beiträge (Interessierte bitte melden: sarah.berendes@rlinstitut.de)
3. Interaktive Diskussion & Methodensammlung
a. Clusterung von Ansätzen & Best Practices
b. Wie können wir komplexe Ergebnisse kommunizier/transferierbar machen?
4. Follow-Up & Vernetzung
a. Ableitung zukünftiger (gemeinsamer) Aktivitäten
Wir laden Forschende, Analyst:innen und Praktiker:innen ein, ihre Erfahrungen zu teilen und gemeinsam Lösungsstrategien für eine effiziente, robuste Energiesystemmodellierung zu erarbeiten.
Saisonale Speicherung als Schlüssel zur Transformation der leitungsgebundenen Wärmeversorgung – Beiträge aus der Energiesystemanalyse
Ansprechperson: Markus Bastek
Motivation
Saisonale Wärmespeicherung ist eine zentrale Voraussetzung für das Gelingen der Wärmewende. Ohne diese ist in der leitungsgebundenen Wärmeversorgung ein 100% EE-System kaum kosteneffizient darstellbar.
Die technische Machbarkeit der entsprechenden Speichertechnologien (beispielsweise Erdbeckenspeicher, Aquiferspeicher oder Bohrlochspeicher) ist zwar in Pilotprojekten im In- und Ausland gezeigt worden, es mangelt aber an der praktischen Umsetzung. Durch ein neues Unterstützungsformat „Urban Arenas – Saisonale Wärmespeicherung“ im Rahmen der Driving Urban Transition Partnerschaft (DUT) sollen deutsche Stadtwerke nun bei Planung und Umsetzung solcher Vorhaben unterstützt werden. Hierbei sind auch entsprechende Beiträge der Forschungslandschaft gefragt.
Im vorgeschlagenen interaktiven Workshop soll diskutiert werden, welche Beiträge die Energiesystemanalyse (durch entsprechende Software und Tools, insb. open source) im Zusammenhang mit der vermehrten Integration von saisonalen Speichern in Fernwärme- und Quartierswärmesystemen leisten kann.
Ablauf
Der Workshop wird von kurzen Impulsvorträgen von Stadtwerke-Vertretern eingeleitet (15 min), welche die Errichtung von saisonalen Wärmespeichern und deren Integration in ein bestehendes Fernwärmesystem planen.
- Im anschließenden interaktiven Teil (60 Minuten) wird, auf Grundlage der Bedarfslage der Stadtwerke-Vertreter, gemeinsam mit den teilnehmenden Forschungsinstitutionen diskutiert:
Was sind die methodischen Herausforderungen beim Einsatz von saisonalen Wärmespeichern aus Sicht der Energiesystemanalyse?
Welche Softwaretools und Werkzeuge (insb. open source) existieren bereits? Welche fehlen noch? Müssen oder können bestehende Werkzeuge ggfs. weiterentwickelt werden?
Wie kann die Qualität dieser Werkzeuge und Tools (z. B. durch Performance-Vergleiche) sichergestellt werden? Wie kann der Wissenstransfer zu den Stadtwerken gelingen?
Zudem soll es für die teilnehmenden Forscher/innen die Möglichkeit geben, von ihnen ggfs. bereits entwickelte Werkzeuge und Tools kurz vorstellen (Pitching Format; max. 2-3 Minuten).
Abschließend werden die in der Diskussion erzielten Ergebnisse zusammengefasst sowie das neue Unterstützungsformat „urban arenas – saisonale Wärmespeicherung“ präsentiert (15 min).
Organisation, Unterstützer und Kooperationspartner
- Driving Urban Transition Partnership
- Projektträger Jülich
- New Energy Capital Invest GmbH
Dynamische Stromnetzmodellierung und Simulation mit OpPoDyn
Ansprechperson: Hans Würfel
Im Rahmen des BMWK geförderten Forschungsprojekts ”OpPoDyn“ entwickeln wir eine Open-Source-Library zur Simulation von Stromnetzdynamik mi einem Fokus auf Forschung und Entwicklung und HPC/GPU. Wir würden das Jahrestreffen gern nutzen um unser Projekt vorzustellen und Input interessierter Nutzer*innen einzuholen.
Der Workshop besteht aus 3 Teilen:
1. Kurzvorstellung der Software und unserer Projektziele (ca. 10 Minuten).
2. Aufsetzen und Durchführung einer einfache Beispielsimulation gemeinsam mit den Teilnehmer*innen (ca. 60 Minuten).
3. Offene Diskussion zu potentiellen Use-Cases und Features die für Teilnehmer*innen besonders relevant oder wichtig w¨aren (ca. 20 Minuten).
Um (2) interaktiv zu gestalten, wäre es ideal, wenn die Teilnehmer*innen die Software auf ihren eigenen Gerraten installieren würden. Falls möglich, würden wir dazu schon im Vorfeld des Jahrestreffens Kontakt aufnehmen um eine Anleitung zur Verfügung zu stellen und individuell zu supporten.
DieTeilnehmeranzahl ist auf 15 Personen begrenzt.
Gerechtigkeit in der Verteilung Erneuerbarer Energien – Methodik und Diskussion
Ansprechpersonen: Marion Wingenbach, Franziska Flachsbarth
Der Workshop richtet sich an maximal 35 Teilnehmende und stellt die im Rahmen des im Januar 2025 abgeschlossenen BMWK-Forschungsprojektes „EmPowerPlan“ entwickelte Methodik zur gerechten Verteilung von Erneuerbaren Energien vor. Ziel ist es, einen Einblick in die entwickelte Methodik zu gewähren, praxisnahe Verbesserungsvorschläge zu sammeln und Potenziale für die Anwendung der Ergebnisse zu identifizieren.
Folgender Ablauf wird vorgeschlagen: Einstieg und Blitzlichtrunde: Nach einem Teaser zum Thema „Gerechte regionale EE-Verteilungen“ sammeln wir spontan entwickelte Gerechtigkeitsvorstellungen der Teilnehmenden und dokumentieren diese strukturiert.
Vorstellung der Methodik: Präsentation der im Projekt berücksichtigten Gerechtigkeitskonzepte, der zugrundeliegenden Berechnungsvorschriften und des Gleichverteilungsalgorithmus. Wir zeigen Ergebnisse für Deutschland, gehen auf regionale Unterschiede ein und diskutieren die Bedeutung der Potentialflächen für die Berechnungsergebnisse.
Angeleitete Diskussion: Im Plenum brainstormen wir, wie die Methodik verbessert werden kann, welche Daten für noch nicht abgedeckte Gerechtigkeitsvorstellungen verfügbar sind und welche weiteren Ansätze denkbar sind.
Konsensansatz: Diskussion unseres Konsensansatzes, der verschiedene Gerechtigkeitsvorstellungen integriert und Konsensflächen sichtbar macht.
Feedback und Anwendung: Gemeinsame Überlegung, wie die Methodik für Regionalplanungen, Energiesystemmodellierungen und die Bestimmung zukünftiger EE-Potentialflächen genutzt werden kann.
Der Workshop lebt von der aktiven Diskussion im Plenum. Kleingruppenarbeit wird bewusst vermieden, um die Debatte in der Gesamtgruppe zu fördern. Feedback und Ideen der Teilnehmenden werden explizit aufgenommen.
Agenda
00:10 - Blitzlicht "Die Positionierung von EE-Anlagen ist gerecht, wenn…"
00:30 - Das Projekt Empowerplan: Entwickelter Algorithmus und implementierte Gerechtigkeitsvorstellungen mit Ergebnissen
00:15 - Ideensammlung: Wie können weitere Gerechtigkeitsvorstellungen als Berechnungsvorschrift ausgedrückt werden? Datenquellen für Verteilschlüssel
00:15 - Der Konsensansatz und Ergebnisse
00:15 - Diskussion der Nutzbarmachung: in der Energiesystemmodellierung, bei der Bestimmung zukünftiger Potentialflächen, in Regionalplanungen
00:05 - Feedback und Wünsche
Workshopsession III
Eingebunden in die Energiewende: Wie können Bürger:innen den Transformationsprozess mitgestalten?
Eingebunden in die Energiewende: Wie können Bürger:innen den Transformationsprozess mitgestalten?
Ansprechpartner: Hawal Shamon, Vanessa Schmieja, Kathrina Vollmer, Stefan Vögele, Jülich Systems Analysis (ICE-2), Forschungszentrum Jülich
Die Energiesystemanalyse ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich mit der Modellierung, Bewertung und Optimierung von Energiesystemen befasst. Ziel der Forschungsdisziplin ist es, wissenschaftlich fundierte Entscheidungsgrundlagen für eine nachhaltige, sichere und kosteneffiziente Energieversorgung zu schaffen. Dabei werden technische, wirtschaftliche, ökologische und soziale Aspekte berücksichtigt.
Ein hoher Grad gesellschaftlicher Akzeptanz bzgl. der Energiewende stellt eine zentrale Bedingung für die erfolgreiche Transformation des Energiesystems dar. Vor diesem Hintergrund hat sich in der Energiesystemanalyse die Berücksichtigung von Akteurs- und Akteurinnen-Präferenzen bereits seit einiger Zeit etabliert. Zudem ist in der jüngeren Vergangenheit seitens der Wissenschaft und Politik ebenfalls der Wunsch nach Einbindung der allgemeinen Bevölkerung ohne formale Wissenschaftsqualifikation in den Wissenschaftsprozess stärker geworden. Die Einbindung von solchen Personen wird unter dem Begriff Citizen Science oder Bürger:innenwissenschaft zusammengefasst. Die sogenannten Bürgerwissenschaftler:innen können ihr Wissen über den Wissenschaftsprozess erweitern und auch dazu beitragen, dass Wissenschaft nicht vom Elfenbeinturm herab an den Bedürfnissen und Ansichten der Bevölkerung vorbeigeplant wird, da sie z. B. zur Genese von Forschungsfragen, zur Datensammlung oder Dateninterpretation beitragen.
In dem von uns angebotenen, interaktiven Workshop (z. B. in Form eines World-Cafés) möchten wir den Workshopteilnehmer:innen eine interdisziplinäre Plattform bieten, um sich über die Wünsche, Anforderungen und Bedürfnisse von Forscher:innen zur Einbindung von Bürgerwissenschaftler:innen auszutauschen. Außerdem sollen in diesem Rahmen Erfahrungswerte darüber geteilt werden, wie man Bürger:innen erfolgreich als Bürgerwissenschaftler:innen gewinnen und in den Wissenschaftsprozess einbinden kann.
Lastenheft für Energieszenarien: Was sollen und was können Energieszenarien leisten?
Ansprechpersonen: Vögele/Schäfer
Energieszenarien kommt bei der Unterstützung energie- und umweltpolitischer Entscheidungen eine wichtige Rolle zu. Die dafür eingesetzten Werkzeuge wurden in den letzten Jahren deutlich verfeinert. Grundsätzlich ist zu hinterfragen, ob und wie die seitens der Stakeholder ex- bzw. implizit gewünschten Anforderungen erfüllt werden. Dies betrifft einerseits die zu betrachteten Input- als auch die berechneten Outputgrößen. In diesem interaktiven Workshop sollen mit ca. 25 bis 35 Personen mit Hilfe von Mindmapping bzw. einem Future Wheels Ansatz mögliche Anforderungen an Szenarien identifiziert werden. In einem zweiten Schritt wird diskutiert, welche Informationen bereits verfügbar sind, bzw. in welcher Form sie vorliegen.
Ziel des Workshops ist es herauszuarbeiten, welche Anforderungen bisher abgedeckt werden, bzw. welcher Bedarf an Forschung noch besteht.
Investitionsentscheidungen im Energiesektor – Ansätze zur verbesserten modellbasierten Abbildung realen Investitionsverhaltens
Ansprechperson: Johannes Kochems
Kurzbeschreibung: Die Energiewende geht einher mit einem erheblichen Investitionsbedarf, sowohl auf der Erzeugungs- als auch auf der Nachfrageseite. Diese Investitionen werden überwiegend von privaten und öffentlichen Unternehmen sowie Haushalten getätigt. Hierbei handelt es sich um eine Vielzahl mitunter heterogener Einzelentscheidungen. „Klassische“ energiesystemanalytische Investitions- und Dispatchmodelle blenden diesen Umstand in der Regel aus. Die Projekte InvestAgent und HAKE sowie das noch in der Antragstellung befindliche Projekt AVEST haben sich daher zum Ziel gesetzt, diese Entscheidungen realitätsnäher in Modellen abzubilden – mit verschiedenen Facetten sowie mit unterschiedlichen Modellansätzen und Fokussektoren. In einem gemeinsamen Workshop sollen nun verschiedene Aspekte der Investitionsentscheidungen und mögliche Modellierungsansätze diskutiert und neue Impulse und Lösungsideen für die Projekte erarbeitet werden. Ziel des Workshops ist es, die Ansätze und Inhalte der drei Projekte breit mit der Forschungscommunity zu diskutieren und über die Projekte hinaus den Austausch anzuregen und Synergien zu schaffen.
Ablauf: Der Workshop ist auf 1,5 Stunden und auf eine maximale Teilnehmendenzahl von 36 Personen angelegt.
Der geplante Ablauf ist wie folgt:
1. Einführung und Zielsetzung (5 min): Begrüßung der Teilnehmenden und kurze Einführung zur Bedeutung von Investitionen im Zuge der Energiewende sowie Vorstellung des Workshop-Konzepts und der Zielsetzung
2. Kurzpräsentation der Projekte InvestAgent, HAKE und AVEST (je 5 min):
- InvestAgent: Untersuchung des Investitionsverhaltens im erneuerbaren Stromsektor mittels akteursfokussierter agentenbasierter Modellierung
- HAKE: Heterogene Akteure: Wie unterschiedliches Investitionsverhalten die Energiewende beeinflusst
- AVEST: Akteursvielfalt und die Umsetzung der Energiesystemtransformation – Analyse von Wärmewende und Erneuerbaren-Ausbau mit dem „Choice-based energy system modeling“
3. Interaktive Diskussion in Kleingruppen (50 min): Nach den Kurzpräsentationen werden zentrale Fragestellungen in Kleingruppen diskutiert, darunter:
- Wie unterscheidet sich das Investitionsentscheidungsverhalten nach
▪ verschiedenen Akteursgruppen, bspw. Haushalte, große gewinnorientierte Unterneh-men, kleinere regional verankerte Unternehmen, …?
▪ verschiedenen Sektoren, bspw. Stromsektor, Wärmesektor, Verkehrssektor?
▪ verschiedenen Technologien, bspw. EE-Erzeugungsanlagen, Backup-Kraftwerke, Batteriespeicher, Wärmepumpen, Elektrofahrzeuge, …? - Wie bewerten Sie die methodischen Konzepte und Ansätze aus
▪ InvestAgent: Agentenbasierte Simulation von Investitionsentscheidungen?
▪ HAKE: Ökonometrische Analyse und modelltheoretische Umsetzung ökonometri-scher Erkenntnisse zu Investitionsentscheidungen heterogener Akteure?
▪ AVEST: Abbildung von diskreten Investitionsentscheidungen heterogener Entschei-der über ein „Choice-based energy system modeling“? - Fallen Ihnen weitere methodische Ansätze ein und weitere Aspekte im Themenkomplex, die adressiert werden sollten?
- Welche Erwartungshaltungen haben Sie an die zukünftige Investitionstätigkeit und Akteurslandschaft im Strom- bzw. Energiesystem?
4. Abschluss und Ergebnissicherung (20 min): Die Ergebnisse der Gruppenarbeit werden im Plenum präsentiert und systematisiert zusammengeführt. Abschließend werden Handlungsempfehlungen und offene Forschungsfragen festgehalten
Adaptive und robuste Transformationspfade für Deutschland und Europa durch Modellierung sektoren-integrierter Energiesysteme
Wasserstoff ist als möglicher Speicher für erneuerbare Stromerzeugung und als Energieträger nicht-elektrifizierbarer Industrieprozesse und Verkehrsbereiche in den Mittelpunkt der Diskussion um treibhausgasneutrale Energiesysteme gerückt. Deren Planung findet im Umfeld wachsender (geo-)politischer, wirtschaftlicher und ökologischer Unsicherheit statt, weshalb zukünftige Energiesysteme meist mittels Szenariomethodik analysiert werden und die Berücksichtigung von Unsicherheiten und unerwarteten Ereignissen in diesem Bereich an Bedeutung gewonnen hat.
Nach einer kurzen thematischen Einführung zum Thema Wasserstoff (5 min) werden im Workshop zunächst die im Projekt ARTESIS mit der Cross-Impact-Bilanzanalyse (CIB) entwickelten Szenarien für das Jahr 2050 vorgestellt und zur Diskussion gestellt (20 min). Nachdem die Teilnehmenden mit den Szenarien vertraut gemacht wurden, werden unerwartete Ereignisse, welche den Verlauf eines Szenarios stören könnten, im Fokus stehen (z.B. Starke Reduktion der Klimaschutzambitionen innerhalb der EU, Kriege, technologische Durchbrüche bei Technologien, die in Konkurrenz zur Wasserstoffnutzung stehen). Um Bias zu vermeiden würden zuerst kritische unerwartete Ereignisse von den Teilnehmenden gesammelt und danach um noch nicht genannte Ereignisse, die projektintern als besonders relevant eingestuft wurden, ergänzt. Anschließend würden die Teilnehmenden die unerwarteten Ereignisse dieser Liste nach Relevanz ranken (30 min). Im Projekt würde dadurch die Auswahl der zu analysierenden unerwarteten Ereignisse um die Sichtweise der Teilnehmenden erweitert; für die Teilnehmenden ergäbe sich dadurch die Möglichkeit, dass die Robustheit der Szenarien an von ihnen als besonders kritisch gesehenen unerwarteten Ereignissen im weiteren Projektverlauf getestet wird.
Anschließend werden den Teilnehmern durch das Fraunhofer ISE quantitative Projektergebnisse aus der aktuellen Studie »Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem« präsentiert. Im Szenario „Robust“ dieser Studie werden geopolitische Unsicherheiten und Klimaveränderungen berücksichtigt und deren Folgen für das deutsche Energiesystem teilweise bis auf Ebene der Bundesländer analysiert. Danach werden inhaltliche Ergebnisse und die verwendete Methodik mit den Teilnehmern diskutiert (25 min). In einer Abschlussdiskussion werden schließlich die wichtigsten Diskussionsergebnisse aus beiden Teilen zusammengeführt (10 min).
Ablauf:
- Impulsvortrag Wasserstoff (5 min)
- Vorstellung ARTESIS-Szenarien (20 min)
- Abfrage und Ranking unerwarteter Ereignisse (30 min)
- Vorstellung und Diskussion »Wege zu einem klimaneutralen Energiesystem« (25 min)
- Abschlussdiskussion (10 min)
Maximale Anzahl an Teilnehmenden: 25
Veranstalter: Christoph Kost (Fraunhofer ISE), Charlotte Senkpiel (Fraunhofer ISE), Wolfgang Hauser (ZIRIUS), Hans Christian Gils (DLR)
Energiesystemmodelle – Wie können sie helfen, die Energiewende effizienter zu gestalten?
Ansprechperson: Prof. Dr. Felix Müsgens (BTU) und Prof. Dr. Dominik Möst (TU Dresden)
# Teilnehmer: Max. 15
Hintergrund und Ablauf: Die Kosten für Energie sind in Deutschland hoch. Teilweise ist dies mit dem erforderlichen Umbau des Energiesystems in Richtung Klimaneutralität zu erklären, teilweise gibt es jedoch auch vermeidbare Mehrkosten durch Ineffizienzen. Oft wird zur Erreichung eines politischen Ziels mehr Geld ausgegeben, als zur strikten Zielerreichung erforderlich wäre. Im Workshop soll es um den Aspekt der volkswirtschaftlichen Effizienz im Energiesystem gehen, d.h. ein gegebenes Ziel mit minimalen volkswirtschaftlichen Kosten zu erreichen.
Darüber hinaus kann auch bei den Zielen diskutiert werden, welche Ziele zur Erreichung eines klimaneutralen Energiesystems bis 2045 erforderlich sind und welche nachgeordneten Ziele wenig zu Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit beitragen, jedoch die Systemkosten stark erhöhen. Die Workshopteilnehmer können hierzu gerne Erfahrungen aus eigenen Modellierungen einbringen.
Die Workshopteilnehmer werden deshalb zu Beginn des Workshops über nachgelagerte Ziele in den Bereichen Umweltverträglichkeit und Versorgungssicherheit diskutieren, und gemeinsam entscheiden, welche in der folgenden Arbeit des Workshops als gegeben betrachtet werden. Im Hinblick auf nachgelagerte Ziele soll hier auch einmal radikal gedacht werden.
Danach wird in Kleingruppen erarbeitet, wie die Klimaneutralität im Energiesystem effizienter erreicht werden kann. Im dritten Teil des Workshops wird dann gemeinsam diskutiert, welche Aspekte sich in Energiesystemmodellen berücksichtigen lassen und wie man die entsprechenden Effekte mit Energiesystemmodellen besser quantifizieren kann.
Kommunale Wärmeplanung mit dem Open Plan Tool
Ansprechperson: Markus Stich
Inhalte
- Kommunale Wärmeplanung mit dem Open Plan Tool: Konzeptionierung und Optimierung einer kommunalen Wärmeversorgung
Ablauf (1,5h)
- Einführung in die Funktionsweise und die Benutzung des Open Plan Tool (20 min)
- Aufgabenstellung zur Erstellung/Optimierung einer Wärmeversorgung (5min)
- Eigenständige Modellierung und Auswertung mit dem Open Plan Tool (Individuell, zu zweit oder in Kleingruppen), die Referenten stehen für Fragen zur Verfügung (45min)
- Rückmeldung zum Ablauf des Workshops, sowie zum Funktionsumfang und der Bedienung des Tools (20min)
Ziele
Austausch über Möglichkeiten, Schwierigkeiten und Lösungsansätze in der Energiesystemplanung
Feedback für die zukünftige Verbesserung und Erweiterung des Open Plan Tools
Teilnehmer
Voraussichtlich 3 Referenten, maximal 25 Teilnehmer
Wärmewende und Sektorenkopplung als Chance für die Kommunen? Wie kann das gemeinsam mit Wirtschaft und Bevölkerung gelingen
Ansprechperson: Maria Reinisch
Workshop VDW e.V. und KIT/ITAS
Der Umstieg auf Erneuerbare Energieversorgung stellt die Kommunen vor große Herausforderungen aber auch für große Chancen? Wie kann dies auf kommunaler Ebene gelingen und wie kann auch die Gesellschaft vor Ort wirksam einbezogen werden?
In dem Workshop werden die Strukturen, Rahmen und der Policy Mix für eine erfolgreiche Transformation vorgestellt und wie vor Ort mit einer Strategiebox flankiert von einem Web-Tool ein gemeinsamer Weg für die Sektorenkopplung gefunden werden kann.
Wie aber lässt sich dieses Konzept auf die Wärmewende anwenden? Wie gelingt hier der Spagat zwischen KWP und den unterschiedlichen Anforderungen und Interessen in der Gemeinde. In zwei interaktiven Workshop werden in Kleingruppen an Tischen
- Wie schaffe ich zielführende Partizipation?
Szenarios für die Wärmewende werden diskutiert und „beschlossen“. Basis sind hier die entstehenden Materialien für die Szenarioworkshops im Projekt KommWärme. An jedem Tisch werden exemplarisch und gemeinschaftlich ein Wunschszenario und eine Vision entwickelt. (VDW)
- Was sind zielführende Maßnahmen als Kommune?
Auf Basis der vorgestellten Materialen und Kernpunkte werden Ergänzungen und Diskussionen zu den aktuellen Notwendigkeiten der Kommunen im Rahmen der Wärmewende mit den Teilnehmern diskutiert und ergänzt (KIT/ITAS). Erfahrungen aus anderen Projekten sind willkommen.
Auf Basis der Pinnwände und der entwickelten Szenarien werden die Ergebnisse kurz vorgestellt. Die Inputs und Ergebnisse fließen dann auch in die weitere Projektarbeit bei KommWärme ein. Das gemeinsame Projekt ZuSkE, das die Basis im Themenfeld der Sektorenkopplung gelegt hat, wird von Kommunen gerne genutzt und ist jetzt auch Teil von LENK in Bayern und wurde beim Land der Ideen ausgezeichnet.
Weitere Informationen
Hier finden Sie alle wichtigen Links sowie weitere Informationen zur Veranstaltung und zum Forschungsnetzwerk Energiesystemanalyse.
Der Veranstaltungsort
Das Jahrestreffen des Forschungsnetzwerks Energiesystemanalyse findet im Maritim proArte Hotel Berlin statt.
Maritim proArte Hotel Berlin
Friedrichstraße 151/Dorotheenstraße 65
10117 Berlin
Forschungsnetzwerke Energie
Sie möchten über aktuelle und zukünftige Aktivitäten im Forschungsnetzwerk Energiesystemanalyse informiert bleiben? Auf der Webseite der Forschungsnetzwerke Energie finden Sie regelmäßig neue Informationen aller Forschungsnetzwerke und anstehenden Veranstaltungen.
Kontakt
Sie haben noch eine Frage zum Jahrestreffen? Dann wenden Sie sich an Dr. Christoph Mang oder Dr. Anna Lewin vom Projektträger Jülich (PtJ).
BMWK
Das Symposium des Forschungsnetzwerks Energiesystemanalyse organisiert der Projektträger Jülich (PtJ) im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK).